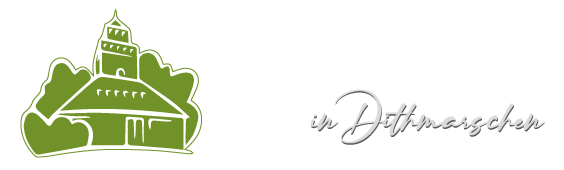Station 4.4:
Petri Kirche

Bevor wir etwas über die Burger Kirche an sich erfahren, begeben wir uns in die Zeit der Christianisierung Dithmarschens und die Gründung der ersten Kirche in Meldorf im Jahr 785:
Die geographischen Gegebenheiten waren damals andere. Die flache Marsch bestand noch nicht und die Nordsee reichte bis an den Geestvorsprung, wo sich heute die Altstadt von Medorf befindet. Da die Miele bei Meldorf in die Nordsee mündete, diente das Dorf Missionaren zur Landung und zur Gründung einer Missionsstation. Die Missionierung der Landbevölkerung war durch Märtyrertode und dem Festhalten an heidnischen Bräuchen nicht ohne gefahrlos, wenn doch sie über die Zeit hinweg erfolgreich war. Doch die Meldorfer Kirche blieb für mehr als 200 Jahre die einzige in Dithmarschen, was für die Bevölkerung teilweise Tagesan- und abreisen bedeutet, um zu kirchlichen Feiertagen oder Taufen dort einzukehren.
Man nimmt heute an, dass 1070 drei weitere Kirchen in Dithmarschen errichtet wurden, Tellingstedt, Weddingstedt und Süderhastedt. 1140 kamen mit Büsum, das damals noch eine Insel war, Lunden und Uthaven, dass sich heute nicht mehr lokalisieren lässt, drei weitere Kirchspiele hinzu.
In einer Urkunde vom 7. Mai 1281 werden Streitigkeiten zwischen Hamburg und Dithmarschen über Piraterie durch Dithmarscher beigelegt. Die Südstrander, zu denen die streitsüchtigen Geschlechter der Kirchspiele Brunsbüttel, Burg, Eddelak und Marne gehörten, hatten sich besonders hervorgetan. Die Hamburger verlangten von den Dithmarschern den Seeraub ihrer Schiffe zu beenden. Zur Einhaltung schlossen sie mit jedem Kirchspiel einen Vertrag, denn die Kirchspiele besaßen große Selbstständigkeit und setzen sich teilweise auch über die Verträge der Landesregenten hinweg.
In diesem Dokument geht nun hervor, dass das Kirchspiel Süderhastedt das neue Kirchspiel Burg von sich abteilt. Für die circa 200 Dorfbewohner wurde es durch den Ausbau der kirchlichen Organisation möglich, die Kirche ohne Tagesanreise zu besuchen. Der erste Bau der Burger Kirche “Kirche zu Bokelenburg” war für die damalige Anwohnerzahl recht groß, so dass die Annahme besteht, dass sie als Wallfahrtskirche dienen sollte. Dafür spricht eine in den Chroniken genannte Reliquie, “St. Peters Haupt”, vermutlich ein in Edelmetall eingearbeiteter Knochen über deren späteren Verbleib keine Aufzeichnungen bekannt sind. Außerdem lasen drei Geistliche die Messe, was ebenfalls für einen Wallfahrtsort spricht.
Das Baumaterial der Burger Kirche besteht aus unbehauenen Feldsteine. In einer Sage von Graf Rudolf, die bis in die 1930er Jahre an der Burger Schule gelehrt wurde, heißt es, dass die Steine von der zerstörten Herrenburg stammen. 1963 fanden Erweiterungsarbeiten statt, während deren Durchführung auch als Fundament gediente Feldsteine ausgetauscht wurden. Einer der Feldsteine besaß eine Mulde und liegt heute in der Nähe des Aussichtstums. Ob dieser zum Getreidemahlen oder um einen Kultstein aus vorchristlicher Zeit handelt, ist nicht bekannt.
Bei den Erweiterungsmaßnahmen wurden die Außenwände teilweise mit roten Ziegeln ausgebessert und danach weiß verschlämmt, um ein einheitliches Bild zu ermöglichen.
Die in der hohen offenen Laterne des Turmes befindliche Bronzeglocke wird als spätgotisch angesehen. Der Kircheingang lag früher, wie in allen Kirchen üblich, in der Westwand. 1654 fanden dort umfassende Sanierungsarbeiten statt, in deren Zuge der Eingang vermutlich an die Nordseite verlegt wurde. Der Anbau nach Süden, auch als “Kreuzkirche” bezeichnet, erfolgte 1700. Im 19. Jahrhundert folgte dann der Einbau der Emporen. Die Erweiterungsbauten waren durch und wegen der wachsenden Bevölkerung ab dem 17. Jahrhundert möglich.
An Inventar ist in der Kirche wenig vorhanden. Der Altar stammt aus dem 15. Jahrhundert und ist mit einer Steinplatte, in die Weihekreuze eingeschnitten sind, abgedeckt. Die Steine liegen unregelmäßig. Früher wurden die Pastoren in der Nähe des Altars beigesetzt, weshalb es denkbar ist, dass es zu Absackungen des Altars und damit zu Verschiebungen der Steine gekommen ist. Die letzte Beisetzung eines Pastors fand dort 1804 statt. Auf dem Altar befindet sich ein mit Blattgold belegtes Holzkreuz an dem ein kleineres Kruzifix befestigt ist.
Der Taufstein aus Kegelstumpf geformten schwedischen Granit wurde 1963 ersetzt. Das frühere Burger Taufbecken aus Gußeisen wurde dem Meldorfer Landesmuseum übertragen.
Die Kanzel wird der Spätrenaissance zugerechnet und stammt vermutlich aus einem Handwerksbetrieb in Wilster. Die Inschrift der Kanzel ist plattdeutsch, was bis 1623 Amtssprache war. An der Kanzelrückwand hängt ein Bild, was den Stifter der Kanzel und des Bildes, Peters Jacob aus Windbergen und seine Familie vor einem Feld unter einem Arabeskenbogen darstellt. Über zwei der drei Frauen ist ein Kreuz gemalt, dass symbolisiert, dass diese zwei Töchter zum Zeitpunkt als das Bild entstand, bereits gestorben waren. 1619 starb seine Frau Else, weshalb das Bild früher entstanden sein muss. Wie lange Perters Jacob, einer der wohlhabendsten Einwohner des Kirchspiels, selbst lebte, ist nicht bekannt.
Ein weiteres, größeres Bild, hängt im Kreuzschiff und zeigt das Jüngste Gericht. Gemalt hat es der Meldorfer Johann Rost, der dafür 40 Mark, umgerechnet 1,5 Kühe erhielt.
Das Segelschiffmodell, ein Dreimastschoner, spendete das Ehepaar Schöning 1922.Detlef und Marie Schöning waren Schiffer und Werftbesitzer in Burg. Heute erinnert das Schiff “Detlef und Marie” die daran, dass Burgs wichtiger Wirtschaftszweig einst die Schifffahrt war.
Orgeln hat die Kirche über die Jahrhunderte hinweg mehrere gehabt. Im Jahr 2022 steht noch die 1994, mit Spendengelder finanzierte Orgel der Firma Kern aus Straßburg.
Gefördert durch